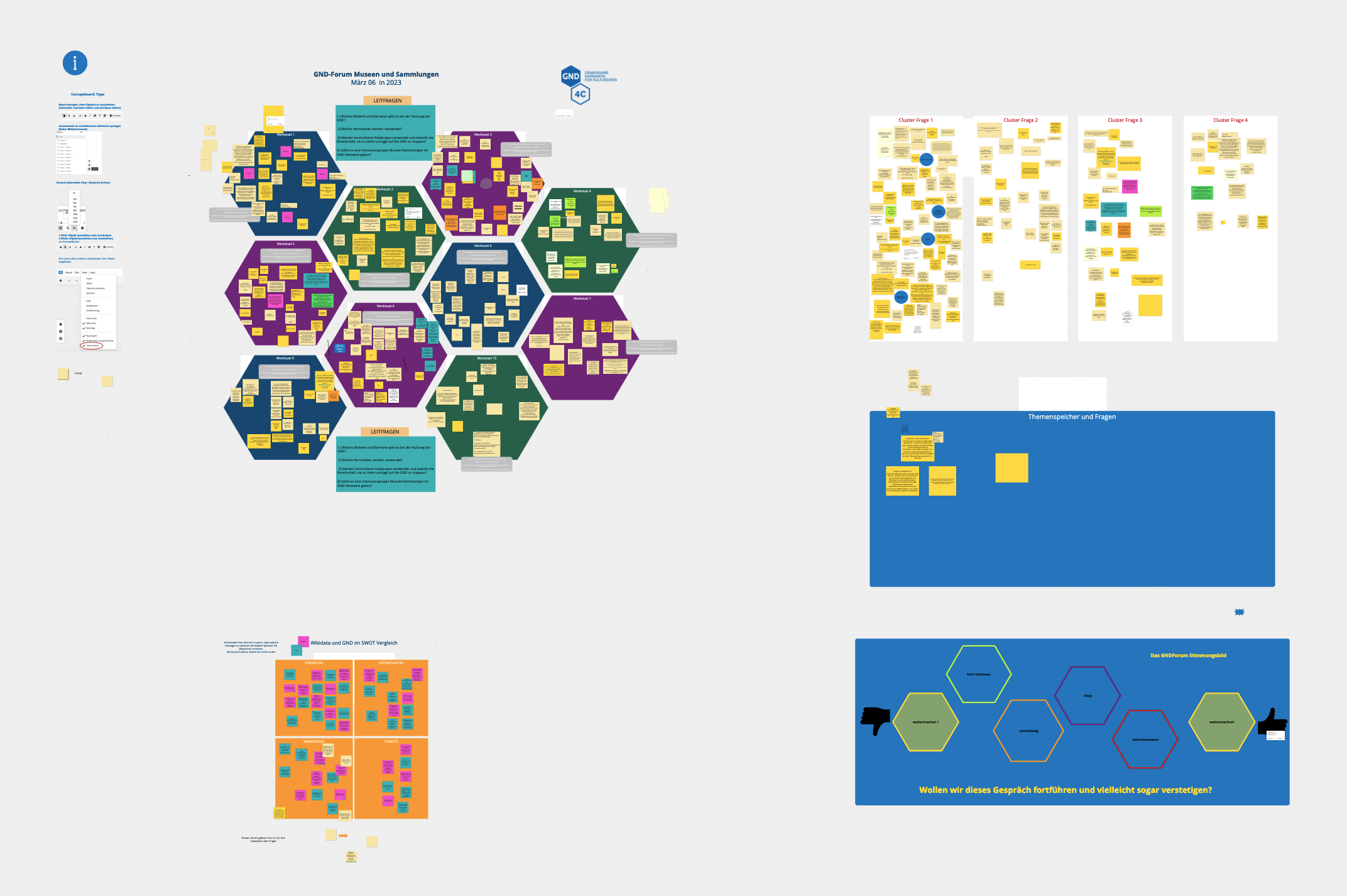Die Dokumentation der Auftaktveranstaltung des GND Forum Museen und Sammlungen ist online
Bericht vom ersten projektübergreifenden Arbeitstreffen der GND-Agenturen mit Fokus auf Datenimport. Ein Beitrag von Stefan Buddenbohm (SUB) und Barbara Fischer (DNB)
Autor:innen: Marie Annisius, Stefan Buddenbohm
Wir, das heißt das GND-Team in der Task Area Infrastructure/Operations in Text+, bestehend aus Kolleg:innen der Arbeitsstelle für Standardisierung der DNB sowie der Abteilung Forschung und Entwicklung und der Gruppe Metadaten an der SUB Göttingen, haben am 26.01.2023 das zweite GND-Forum Text+ durchgeführt. Zuerst ein Dankeschön an alle 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Text+, aus anderen Konsortien, aus dem großen Team der DNB selbst sowie den Fachverbänden und Fachinformationsdiensten! Ziel des Treffens war es, über den neuesten Arbeitsstand der verschiedenen Aktivitäten die GND im Zusammenhang mit Text+ betreffend zu informieren. Anders als beim Auftaktforum im Juni 2022 ging es dieses Mal vor allem darum, der Community einen Einblick in den GND-Task in Text+ selbst sowie in die übergreifenden Aktivitäten der DNB beim Thema zu vermitteln. Beim nächsten Forum werden dann die Datendomänen aus Text+ mit ihren Normdatenaktivitäten im Mittelpunkt stehen. Das dritte GND-Forum Text+ wird voraussichtlich im Sommer oder Herbst dieses Jahres stattfinden. Im Folgenden geben wir eine Zusammenfassung des letzten Workshops. (Fast Lane: Alle Materialien finden sich am Ende dieses Blogposts verlinkt.)
Aktivitäten in der Text+ Task Area Infrastructure/Operations
Ausschnitt aus dem Whiteboard des GND-Designworkshops 2022
Ein kurzer Bericht vom Community-Empowerment Workshop am 06.12.2022 ((Dokumentation des Workshops Kollaborative Konzeptarbeit: Wissensvermittlung für die GND-Community)) leitete den Workshop ein und beleuchtete die Zielrichtung für Schulungsmaterialien rund um die GND. Geplant sind ein modularer Baukasten von Lerninhalten, verschiedene Vermittlungsformate und Methoden sowie eine Materialsammlung auf der GND-Website. Im nächsten Schritt wird dazu eine Customer Journey ausgearbeitet. Konsens ist, wo immer dies möglich und einfach umsetzbar ist, nach Synergien zu streben. Die NFDI bietet dafür einen verbindlichen Rahmen und mit der DNB ist ein sehr erfahrener Partner mit “langem Atem” involviert. So unterschiedlich die Datendomänen der Nutzenden sind, so finden sie doch mit der GND einen etablierten “infrastrukturellen gemeinsamen Nenner”. Daher ist es sinnvoll, für Schulungsmaterialien und Beratungen nicht das Rad neu zu erfinden und rechtzeitig in den Dialog mit anderen zu treten, die eine ähnliche Zielgruppe adressieren. Mit der Gruppe der geistes- und kulturwissenschaftlichen Konsortien – NFDI4Culture, NFDI4Memory, NFDI4Objects sowie Text+ – existiert eine Peer Community, die dieses Thema gemeinsam diskutieren kann.
Die Teilnehmenden des GND-Designworkshops am 06.12.2022
Die GND-Umfrage, die Ende 2022 in der Text+ Community durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass über die GND bereits viel bekannt ist. Die Bedarfe liegen vor allem in vereinfachten Beteiligungsmöglichkeiten, Abgleichsmöglichkeiten sowie in mehrsprachigen Vokabularen. Text+ als NFDI-Konsortium setzt auf die aufzubauende GND-Agentur Text+, um der Community der Datengebenden und Datennutzenden im Kontext sprach- und textbasierter Forschungsdaten als Unterstützung zur Seite zu stehen.
Die Möglichkeiten für den Abgleich von Daten liegen im
- vollständig händischen Abgleich,
- semi-automatischen Abgleich von Datendumps nach bestimmten Bedingungen, die nach einer gründlichen Betrachtung der Datensets festgelegt werden, bspw. hierarchische Strukturierung der Daten,
- vollautomatischen Abgleich im Bereich der Sachbegriffe, welcher weniger verbreitet und für Individualnamen besser geeignet ist.
Technische Infrastruktur der GND – Aktuelle Entwicklung
Jürgen Kett gab einen Überblick über die Entwicklungen der technischen Infrastruktur der GND, von Organisation und Kommunikation über die Erweiterung der Datenbasis, Datenvernetzung, Datenredaktion sowie Regel- und Formatdokumentation bis hin zu Werkzeugen und Schnittstellen.
Es gibt viele heterogene Anforderungen an die GND und damit auch an die Infrastruktur. Ausschlaggebend für den Erfolg der Infrastruktur ist somit ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Nutzungsszenarien. Mit Blick auf die NFDI kann es bereits bei den geistes- und kulturwissenschaftlichen Konsortien zu einem Spektrum unterschiedlicher Anforderungen kommen, einfach weil mit unterschiedlichen Forschungsdaten gearbeitet wird.
Ein Ziel ist, das GND-Netzwerk sichtbar zu machen, um so zur Interaktion einzuladen und zu Feedback aufzufordern. Der GND-Explorer bietet einen einfachen Einstieg in die Suche in der GND. Geplant sind in Zukunft Features wie eine Karten- und Zeitstrahlansicht, verkürzte Meldeverfahren und auch die Darstellung von Relationen zu externen Ressourcen, welche die GND verknüpfen ebenso wie Community-Sichten (bspw. für ausgewählte Datenräume oder -typen) und die Integrierbarkeit in Partner-Anwendungen.
Ein weiteres geplantes Angebot ist der One-Stop-Shop: Hier sollen APIs angeboten werden. Dazu werden aber zunächst Integrationsschnittstellen benötigt, die nach der Fertigstellung auch als externe Schnittstellen dienen können. Als Eingabeoberflächen sind Webformulare für Geografika geplant sowie die Integration in Drittsysteme (RISM, ISNI). Bereits erfolgt ist die Integration von ORCID.
Screenshot aus der Präsentation von Jürgen Kett
Ausschnitt aus dem Infrastrukturkonzept der GND
Im Themenbereich der Regeln und Formatdokumentation wäre eine Sonderarbeitsgruppe Text+ innerhalb der Gremienstruktur der GND denkbar. Bereits eingeführt ist das Konzept der Anwendungskontexte. Diese können das Taggen von community-spezifischen Regeln enthalten oder die Nutzung von Datensätzen als Ganzem oder nur einzelner Datenfelder (PLUS-Markierung) in einer spezifischen Weise. Anwendungskontexte bieten die Möglichkeit, verschiedene Ansichten der GND zu filtern. Aber es gilt: Wir arbeiten weiterhin alle in einer GND. Die verschiedenen Bedarfe der Communities an die Regeln und an das Datenmodell stellen somit eine bleibende Herausforderung dar.
Das Konzept für die semi-automatische Datenintegration (Massen-Integration) sieht das Matching in der Verantwortung der einzelnen Communities. Es erfolgt der Abgleich der Sammlungs-/ Objekt-/ Forschungs-Daten mit der GND. Fehlende Kandidaten können dann als Vorschläge in die GND eingebracht werden. Um GND-URIs angereicherte Sammlungs-/ Objekt-/ Forschungsdaten werden damit Teil des GND.networks.
Eine GND-Agentur für Text+ – erste prototypische Workflows
Im letzten Teil stellte Susanne Al-Eryani die geplanten Angebote der GND-Agentur Text+ mit Fokus auf die Bereiche Kontakt, Beratung und Datenservices vor und gab einen Einblick in den geplanten Workflow zur Verarbeitung von eingehenden Forschungsdaten. Dieser Workflow bildet einen wichtigen Beitrag zur entstehenden GND-Agentur Text+.
Der untenstehende Workflow in schematischer Darstellung ist das Ergebnis der Arbeit seit Projektbeginn von Text+ und spiegelt vor allem die Rückmeldungen und Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit drei Pilotprojekten wieder. Bei diesen Pilotprojekten handelte es sich um die Carl Schmitt-Tagebücher, die Klaus Mollenhauer-Gesamtausgabe sowie Gelehrte Journale und Zeitungen der Aufklärung, alle drei Editionsprojekte, die mit der Georg-August-Universität Göttingen verbunden sind.
Schema des geplanten Workflows zur Verarbeitung von eingehenden Forschungsdaten.
Die Erhebung der Bedarfe und Ausgangsbedingungen wurde mithilfe eines strukturierten Leitfadens durchgeführt. Standen bisher Editionen im Mittelpunkt, wird der Workflow zukünftig auf andere Datentypen auszuweiten sein.
Ein wesentliches Ergebnis der Arbeit ist mit entityXML ein Austausch- und Speicherformat, mittels dessen die Normdatenmeldung aus Forschungsprojekten an die GND erfolgen kann. Das Werkzeug wird im Frühjahr 2023 offiziell veröffentlicht.
Screenshot aus der Präsentation von Uwe Sikora
Wie geht es weiter?
Während der verschiedenen Diskussionen wurden Fragen aufgeworfen, die nicht alle im Verlauf der Veranstaltung geklärt werden konnten, zum Teil auch gar nicht sollten, und die es gilt, in Zukunft anzugehen, bzw. die eine Anregung für zukünftige Arbeiten darstellen können:
- Mit welchen Datenzentren/Datenbeständen aus den Datendomänen Sammlungen und Lexikalische Ressourcen können/wollen wir im Rahmen der Forumsreihe und im GND-Task in Text+ weiterarbeiten?
- Welche externen Zielgruppen wollen wir einbinden? Reicht das GND-Forum Text+ oder braucht es mehr/andere Formate?
- Besteht Interesse an einem Workshop/Erfahrungsaustausch zum Abgleich von Daten mit der GND z. B. via Open Refine?
- Wie lassen sich die durch GND Mul geschaffenen Möglichkeiten/Infrastrukturen durch Text+ nutzen, z. B. für die Registry?
GND-Forum als Blueprint – bitte nachmachen!
Das GND-Forum Text+ bettet sich ein in eine Palette ähnlich ausgerichteter Foren, die mit Hilfe der DNB für ganz unterschiedliche Zielgruppen angeboten werden: das GND-Forum Performing Arts, das GND-Forum Bauwerke, das GND-Forum Archiv oder das GND-Forum Museen und Sammlung. Allen gemein ist die Zielsetzung, das Thema Normdaten und das GND.network an die spezifischen Bedarfe unterschiedlicher Communities heranzutragen, anzupassen, mit ihnen gemeinsamen weiterzuentwickeln. Die GND, insbesondere die Arbeitsstelle für Standardisierung, unterstützt dabei maßgeblich und ist auch – im Falle von Text+ – konkret an der Arbeit im NFDI-Konsortium beteiligt. In Text+ fließen die normdatenbezogenen Aktivitäten im GND-Task der Task Area Infrastructure/Operations zusammen. Text+ adressiert während der Laufzeit vor allem die drei Datendomänen Sammlungen, Editionen und Lexikalische Ressourcen, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus den Fachinformationsdiensten, den Fachverbänden sowie anderen NFDI-Konsortien.
Damit wird deutlich, dass ein ganz wesentlicher und kritischer Erfolgsfaktor für die weitere Verbreitung und Nutzung (upscaling) der GND der intensive Dialog mit den spezifischen Communities ist. Für Text+ sind das vor allem Projekte und Institutionen, die sich mit text- und sprachbasierten Forschungsdaten befassen. Den Dialog in Gang zu setzen und in Bewegung zu halten ist für ein Projekt wie Text+ eine Herausforderung, da verbindliche und zielgerichtete Kommunikation Vertrauen und eine gewisse Frequenz bedingt. Aus diesem Grund sind die praktischen Umsetzungen aus den Text+ Datendomänen so wichtig, um der Community Anreize zum Mittun zu geben.
Das dritte GND-Forum Text+ ist für den Sommer/Herbst 2023 geplant und wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen! Wenn Sie mit uns abseits der Workshopreihe in Kontakt treten möchten, Fragen haben oder vielleicht ein kleines Projekt aus ihrem Kontext umsetzen wollen, freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie dafür einfach an die Verantwortlichen für den GND-Task in Text+ Barbara Fischer, Marie Annisius und Stefan Buddenbohm oder wenden Sie sich an unseren Text+ Helpdesk.
Erstmals fand am 14. November 2022 ein GND-Forum zum Thema Bauwerke statt. Veranstaltet wurde die virtuelle Konferenz von dem Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg (DDK), der Deutschen Nationalbibliothek (DNB), dem Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, der Technischen Informationsbibliothek Hannover (TIB) und der Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL). Es wurden dabei folgende Fragen diskutiert: Wie entstehen Normdaten? Wie können sie genutzt werden? Wie werden sie bereits genutzt? Welche Zwecke und Funktionen erfüllen sie im Netz der Daten zu Bauwerken?
Die Teilnehmenden am GND-Forum waren sich einig: Normdaten sind ein zentraler Schlüssel zur Interoperabilität im Datenraum Bauwerke. Zu den Erwartungen und Vorschlägen der Teilnehmenden, wie Normdaten zur Verbesserung der Qualität ihrer Daten eingesetzt werden können, lesen Sie bitte die nachstehende ausführliche Dokumentation.
Autor*innen des Beitrages: Christina Teufer-Hansen, Slawek Brzezicki, Martha Rosenkötter, Julia Rössel, Susanne Arndt und Barbara Fischer
Dokumentation des GND-Forums zum Datenraum Architektur, Bauwerke und Denkmale
Wie entstehen Normdaten? Wie können sie genutzt werden und wie werden sie bereits genutzt? Welche Zwecke und Funktionen erfüllen sie im Netz der Daten zu Bauwerken?
Solche und viele andere Fragen waren Ausgangspunkt für die Diskussion beim ersten GND Forum Bauwerke. Mitte November kamen circa einhundert Teilnehmer*innen zu einem virtuellen Austausch zusammen. Die Veranstalter des Forums, namentlich das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg (DDK), die Deutsche Nationalbibliothek (DNB), das Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB) und die Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL), hatten eingeladen. Interdisziplinär diskutierte die Gemeinschaft derjenigen, die Forschung oder Dokumentation von Bauwerken und ortsfesten Werken betreiben, in diesem Kontext entsprechende Daten generieren, verarbeiten und nutzen, Fragen der Standardisierung und der Nutzung von Normdaten.
Ziel der Veranstaltung war es, einerseits über die GND zu informieren, aber auch zu zeigen, wie wichtig die Vernetzung und der Diskurs über das Thema Normdaten, deren Erstellung und Nutzung sein kann. Gerade für die aktive Beteiligung an der sich anderen Fachdisziplinen öffnenden GND ist es relevant, sich als Fachgemeinschaft zu finden, sich auszutauschen, Interessensschwerpunkte auszuloten, um die eigenen Interessen in Bezug auf Normdaten nachdrücklicher vertreten zu können.
Auf dem Programm der ganztägigen Veranstaltung, die von Barbara Fischer (DNB) und Julia Rössel (DDK) moderiert wurde, wechselten sich Vortragsblöcke mit intensiven Austausch in Arbeitsgruppen, sogenannten Break out Sessions zu unterschiedlichen Fragestellungen ab. Der Vormittag startete mit zwei einleitende Beiträgen. Angela Kailus (DDB) gab einen informativen Überblick über die Thematik der Normdaten, indem sie der Frage „Warum sollte man Normdaten verwenden?“ nachging. Es folgte ein Zwiegespräch zwischen Prof. Ina Blümel (TIB) und Dr. Christian Bracht (DDK), bei dem die heterogene Landschaft der bauwerksorientierten Fachgebiete, Projekte und Aktivitäten kartiert wurde.
Die im Aufbau befindliche Pilotagentur Bauwerke, angesiedelt am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg, ist einer der Akteure der wachsenden Interessengemeinschaft des Datenraums Bauwerke. Im Zuge des Projektes GND für Kulturdaten (GND4C) trägt sie aktiv zur Öffnung der GND bei und hat Anforderungen für die Erfassung von Normdaten zu Bauwerken für den Anwendungskontext der Bauwerke-Community ausgearbeitet. Diese wurde im zweiten Block der Veranstaltung von Martha Rosenkötter (DDK) und Matthias Manecke (DNB) vorgestellt. Hieran schloss sich unmittelbar eine Break out Session an, in der Fragen und Positionen zu den vorgestellten Erfassungsregeln ausgetauscht wurden. In weiteren Break out Sessions wurde unter anderem diskutiert, welche Barrieren und Bedarfe in der Community hinsichtlich der GND gesehen werden, welche Kriterien für die Erfassung von Bauwerken in der GND gelten und wie granular diese erfasst werden sollten. In einer weiteren Session befasste man sich mit den Möglichkeiten der Koreferenzierung in Fachthesauri wie AAT oder CONA und der GND. Am Ende des Tages wurden die wesentlichen Punkte aus den Diskussionsrunden im Plenum zusammengetragen und debattiert, wie man die Arbeit fortsetzen könnte.
Das Feld auf dem wir uns bewegen - die Entwicklung der GND im Kreis ihrer "Nachbarn"
Im Zwiegespräch zwischen Ina Blümel (TIB) und Christian Bracht (DDK) wurde das Umfeld der GND im Kontext der Open-Science-Bewegung diskutiert. Normdaten und kontrollierte Vokabulare bieten bei der Auszeichnung des eigenen Datenbestandes einen wichtigen Vorteil, denn sie gewährleisten die "Eindeutigkeit von Dingen der Welt im Netz". Hierbei spielt vor allem die Vernetzung einzelner Vokabulare (z.B. Arts and Architecture Thesaurus, Wortnetz Kultur, Wikidata oder lokale Systeme) untereinander eine wichtige Rolle. In der zugehörigen Break out Session "Koreferenzierungen in der GND - Was brauchen wir und wie kann es klappen?" wurden Mappings und Konkordanzen entsprechend als "Weichenstellung für die Zukunft" verstanden.
Die GND könnte Zielentitäten für diese Vernetzung liefern, allerdings müssen solche Entitäten zunächst in die GND eingebracht werden. Noch sind die Beteiligungswege zur Einbringung von Entitäten in die GND einem Teil der Bauwerke-Community nicht deutlich genug. Insgesamt wurde ein Bedarf zur Vermittlung von Basiskenntnissen im Umgang mit GND-Daten und anderen Vokabularen erkannt, z.B. über
- Beteiligungswege (GND Network),
- geeignete Tools (Open Refine, cocoda, GND-Schnittstellen),
- Anforderungen an die Vorbereitung von Daten zur semi-automatischen Einspielung in die GND.
Einem anderen Teil der Bauwerke-Community sind die Beteiligungswege zu indirekt: die zur Qualitätssicherung notwendige redaktionelle Einbindung über die GND-Kooperative erfordert den Umweg über Bibliotheken, Agenturen und Verbundzentralen, so dass hier Hürden für eine unmittelbare und forschungsnahe Erweiterung der GND bestehen. Eine konkrete Forderung bestand in einer vereinfachten und direkteren Einbringung von Normdatensätzen in die GND durch die Community. Generell wurde eine stärkere Öffnung des Redaktionsworkflows nach dem Modell Wikidata als wünschenswert erachtet, wobei jedoch der Aspekt der Qualitätssicherung nicht außer acht gelassen werden darf.
Ein weiteres Hindernis für die Beteiligung an der Entwicklung von Normdaten wurde darüber hinaus in den erforderlichen Personalressourcen gesehen, die oftmals nicht vorhanden sind - Erschließungsarbeit in datensammelnden Einrichtungen wird meist nicht hinreichend und nachhaltig gefördert. Dies ist eine kulturpolitische Aufgabe, die die Community konstant anmahnen muss, um ihr Gehör zu verschaffen.
Wie es weitergehen kann, ein Ausblick.
Bei einem abschließenden Plenum wurden die zentralen Themengebiete des Treffens zusammengebracht und zugehörige Punkte gemeinsam diskutiert. Allgemein konnte für die Auftaktveranstaltung die positive Bilanz gezogen werden, dass innerhalb der Community großes Interesse und Bedarf an Normdaten für Bauwerke besteht. Umso relevanter erscheint es, die Bemühungen zur Verstetigung der Pilotagentur Bauwerke, die im Rahmen des GND4C-Projektes erste Erfolge erzielen konnte, weiter zu führen und so eine Anlaufstelle für die Community zu bilden.
Im Zuge dessen könnte etwa dem mehrfach geäußerten Wunsch nach Schulungsangeboten und informative Publikationen zu technischen Infrastrukturen für die Nutzung von Normdaten im eigenen lokalen System nachgekommen werden. Darüber hinaus kann sie zu Anforderungen und Qualität von Bauwerksdaten beraten, die in der GND als Normdaten publiziert werden sollen.
Die Formierung einer Interessengruppe kann zukünftig dazu verhelfen, der Dringlichkeit weiterer beim Forum formulierter Bedarfe, wie etwa eine stärkere Beteilung der Gemeinschaft an der Eingabe der Datensätze über eine Eingabemaske für Bauwerke, mehr Gewicht zu verleihen. Für diese müssen allerdings auch genügend GND-Redaktionen in der Lage sein, die eingegebenen Daten auf ihre formale und inhaltliche Korrektheit in zu prüfen um letztlich qualitativ hochwertige Normdaten zur Verfügung zu stellen. Aber auch fachliche Fragen, etwa nach der Abbildung von Beziehungen zwischen Vorgänger- und Nachfolgebauten oder der Aufnahme von nicht realisierten Bauwerken als Werke in der GND müssen innerhalb der Interessengruppe weitergeführt werden.
Noch gibt es viele Barrieren, die eine Mitarbeit an der GND für die Bauwerke-Communtiy erschweren: Neben den vielfach fehlenden finanziellen und personellen Mitteln auf allen Seiten, erschwert der notwendige Fokus der GND auf Institutionen als dauerhafte Mitglieder ihres Netzwerks die Partizipation kleinerer oder weniger langfristig arbeitender Akteure, wie etwa Forschungsprojekte. Da die Anreicherung der GND um Bauwerksnormdaten ein interdisziplinäres Arbeiten erfordert, ist es zudem notwendig eine gemeinsame Sprache für die Erfassungsregeln zu finden, die derzeit für Personen ohne bibliothekarische Ausbildung mitunter schwer verständlich sind. Zudem ist vielfach unklar, an wen man sich mit Anfragen zur Anpassung oder Korrektur von bestehenden Normdaten zu Bauwerken wenden kann.
Leider wird die Relevanz der Nutzung von Normdaten für die Erzeugung eigener Bauwerksdaten von Entscheidungsträgern oft als nachrangig beurteilt. Dabei sprechen viele Leitlinien, wie z.B. die FAIR-Prinzipien, davon, dass die Qualität von Daten mit ihrer Interoperabilität gewinnt. Normdaten sind ein zentraler Schlüssel hierzu. Um sie besser nutzen zu können und die Menge an Bauwerksdaten zu steigern, die wiederum die Nutzungsmöglichkeiten erhöht, ist eine aktive Beteiligung der Community notwendig. Dass viele zum gemeinsamen Engagement und zur Mitarbeit an der GND motiviert sind und somit auch die Diskussion um die Gründung und Schwerpunkte einer Interessengruppe weitergeführt werden möchte, ergab das Stimmungsbild am Ende des Plenums (Abbildung 4).
Ziel ist es, sich weiter zu treffen und auf dem nächsten GND-Forum Bauwerke die stärkere Beteiligung der Bauwerke-Community an der GND und ihre Anreicherung mit Normdaten zu Bauwerken zu konkretisieren.
Ergänzendes Material zum GND-Forum Bauwerke
Vortrag "Warum sollte man Normdaten verwenden?", von Angela Kailus (DDK)
Vortrag "Sammlung bauwerksbezogener Anforderungen an die GND", von Martha Rosenkötter (DDK)
Vortrag "Werkstattbericht: Die GND Erfassungsregeln für Bauwerke in der neuen STA-Dokumentationsplattform", von Mathias Manecke (DNB)
Der Tweet bildet das Stimmungsbild der Community ab. (Abbildung 4)
Die Veranstalter des GND Forum Bauwerke - Dialog rund um Bauwerksdaten und Standardisierung
am 14. November 2022
Fragen und Antworten auf dem GND-Forum Bauwerke
Im Laufe der Veranstaltung wurden erfreulich viele Fragen gestellt. Viele Antworten bietet bereits die FAQ-Seite der GND-Website. Im Rahmen der Dokumentation nehmen wir daher besonders solche Fragen auf, die dort nicht beantwortet werden. Wir haben die Fragen nach vier Bereichen kategorisiert.
Wie stellt sich die GND-Kooperative konkret die Mitarbeit vor? Wir haben alle wenig Kapazitäten. Ist auch an Stellen gedacht worden?
Die Communities, die die GND nutzen möchten, müssen selbst ihren Bedarf an einer guten Datenqualität und Referenzierung mittels Normdaten ihren Fördermittelgebern kommunizieren und die hierfür entsprechende Ressourcen einfordern. Hier gilt es, verstärkt die Bundesländer im Zuge ihrer Digitalstrategien in die Pflicht zu nehmen.
Muss man sich für ein Vokabular entscheiden?
Nein, man muss sich nicht für oder gegen ein Normvokabular entscheiden, auch nicht für oder gegen Wikidata, aber im Sinne einer ressourcenbewußten Arbeitsweise sollte man sich eine für die eigenen Bedarfe sinnvolle Schrittfolge der Anwendung entscheiden. Beispielsweise zuerst den Allgemeinbegriff in der GND nachschlagen, wenn man dort nicht fündig wird, im AAT und schließlich zumindest die Wikidata ID einfügen, um die Vernetzung der eigenen Daten zu befördern. Die GND bietet sehr viele Normdaten zu Personen an, für spezielle Fachbegriffe gibt es hingegen entsprechende Thesauri mit persistenten Identifikatoren, wie der AAT. Wikidata aggregiert Normdaten ist aber selbst keine Normdatenbank.
Wer kann GND-Datensätze schreiben und wie erhält man diese Rechte?
- Wer in der GND Datensätze anlegen und bearbeiten will, muss an die GND-Kooperative angebunden sein. Diese stellt die Qualität und Pflege der eingebrachten Daten nachhaltig sicher. Je nach Region, Thema oder anderen Kriterien bieten sich unterschiedliche Agenturen als Partner an. Mehr Information bietet die Website.
Welche Rolle spielen die GND-Agenturen bei der Senkung der Einstiegshürden beziehungsweise für die Partizipation?
Agenturen spielen eine wichtige Rolle in der Öffnung der GND, um neue Anwender*innen als GND-Editor*innen zu integrieren. Eine Agentur übernimmt Beratungs-, Orientierungs- und Schulungsaufgaben für ihren Kundenkreis. Eine Agentur kann Feedback aus ihrer Community oder über die Interessengruppen einer spezifischen Domäne aufnehmen und entsprechenden Änderungen anstoßen. Mehr Information bietet die Website.
Besteht die Möglichkeit zur ehrenamtlichen Teilhabe?
In der Regel sind Anwender*innen, die GND Datensätze anlegen, Mitarbeitende in Einrichtungen, die der GND-Kooperative angeschlossen sind. Freiwillige der Wikipedia-Community beteiligen sich jedoch in einem speziell für sie eingerichteten Workflow an der Korrektur von GND-Datensätzen.
Wie lauten die Relevanzkriterien für Bauwerke in der GND?
- Die GND-Gemeinschaft hat Eignungskriterien definiert. Diese legen fest, welche formalen Kriterien erfüllt sein müssen, um Entitäten als Normdaten in der GND aufzunehmen. Fachlich muss sich die jeweilige Community eigenständig zur Relevanz von Entitäten als Normdaten verständigen. Sie wird dabei abwägen müssen, was sie an Editions- und Pflegeaufwand bei den Normdaten ihres Bedarfs mit den ihr zu Verfügung stehenden Ressourcen leisten kann.
Warum definiert man die „Identität“ eines Gebäudes nicht einfach über die Geokoordinaten?
- Zum einen gibt es Bauwerke, Teile von Bauwerken oder Monumente, die im Laufe der Zeiten ihren Standort ändern. Zum anderen sind Geokoordinaten keine Identifikatoren im Sinne einer Uniform Resource Identifier (URI) und einer daran geknüpften Internetadresse (URL).
Wie können Vorarbeiten aussehen, um Daten besser für die GND vorzubreiten?
Eine gute Praxis wäre die Adaption bestimmter Standards in den eigenen Beständen. Ein Ausgangspunkt könnten die Mindestanforderungen der GND für die Erfassung von Bauwerken sein. Neben der GND kann man sich anderer Standards – für Bauwerke eignet sich vor allem LIDO – bedienen, die eine feingranulare Beschreibung von Bauwerken erlauben, die in der GND nicht vorgesehen ist.
Wie ist der Diskussionsstand hinsichtlich der Einbindung von Vokabularen wie AAT und anderen in die GND?
Ansätze hierzu werden im GND Mul Projekt zu entsprechenden Workflows umgearbeitet. Diese Methodik wird bisher nur auf große Thesauri und Normdaten anderer Nationalbibliotheken angewendet, geplant ist, diese Art der Verknüpfung auch für kleinere Fachvokabulare zu nutzen. Dies soll weiter ausgelotet werden.
Wie kommen die Wissenschaftler*innen schnell an die richtigen Normdaten in der GND?
- Einzelne Datensätze und deren Verknüpfungen lassen sich gut mit dem GND-Explorer recherchieren. Viele Software-Anbieter bieten auf Wunsch eine integrierte Recherche-Schnittstelle zur GND an. Weitere Recherchemöglichkeiten auch für umfänglichere Abgleiche findet man auf der GND-Website.
Wird es möglich sein, über ein Webformular Daten zu Bauwerken einzugeben?
- Derzeit gibt es Webformulare zu Personen und Körperschaften, demnächst auch zu Gebietskörperschaften. Als Alternative zu den kostenintensiven Einzelentwicklungen arbeitet die DNB derzeit an einer Wikibase-basierten Lösung mit benutzerfreundlichen Oberflächen, die das regelkonforme Anlegen von Entitäten in der GND erleichtern werden.
Die Zeit ist ein seltsames Phänomen. Einerseits läuft sie akribisch genormt und unerbittlich ab. Andererseits machen wir alle die Erfahrung, dass zum Jahresende die Zeit irgendwie verrückt spielt. Sie läuft sozusagen zugleich zu langsam – die Tage sind übervoll mit ellenlangen To Do Listen und Terminen. Was letzte Woche war, liegt gefühlt Monate zurück. Gleichzeitig viel zu schnell, denn jedes Jahr aufs Neue ist ganz unvermittelt Weihnachten. Dann die ersehnte Winterpause. Letztere dehnt sich, so lange sie im Morgen liegt, gefühlt ewig, daher müssen wir ja unbedingt vorher so viel noch erledigen, klären und fertig machen. Doch schon am Tag des Beginns schnurrt sie zusammen, wie eine trockene Apfelschale. Nach der Pause gewöhnt man sich rasch an die neue Jahreszahl. Alle Daten mit der “2” am Ende sinken in die Vergangenheit ein, bereit vergessen zu werden.
Halt, möchte man da rufen, da waren doch Momente, die nicht so schnell verblassen sollten. Keine Sorge, dies ist weder der Ort, für berechtigt düstere Jahresrevuen und Previews, noch für langatmige Jahresrückblicke. Stattdessen laden wir Sie ein, auf unsere Imago-Rückblenden zu klicken, so surfen Sie mit uns durch ein paar spezielle Augenblicke des stets unnormalen GND-Jahres.
Und kommen Sie gut rüber, wünscht Ihnen das GND Team.
Beitrag von Verena Mack (Landesarchiv Baden-Württemberg | GND-Agentur LEO-BW-Regional)